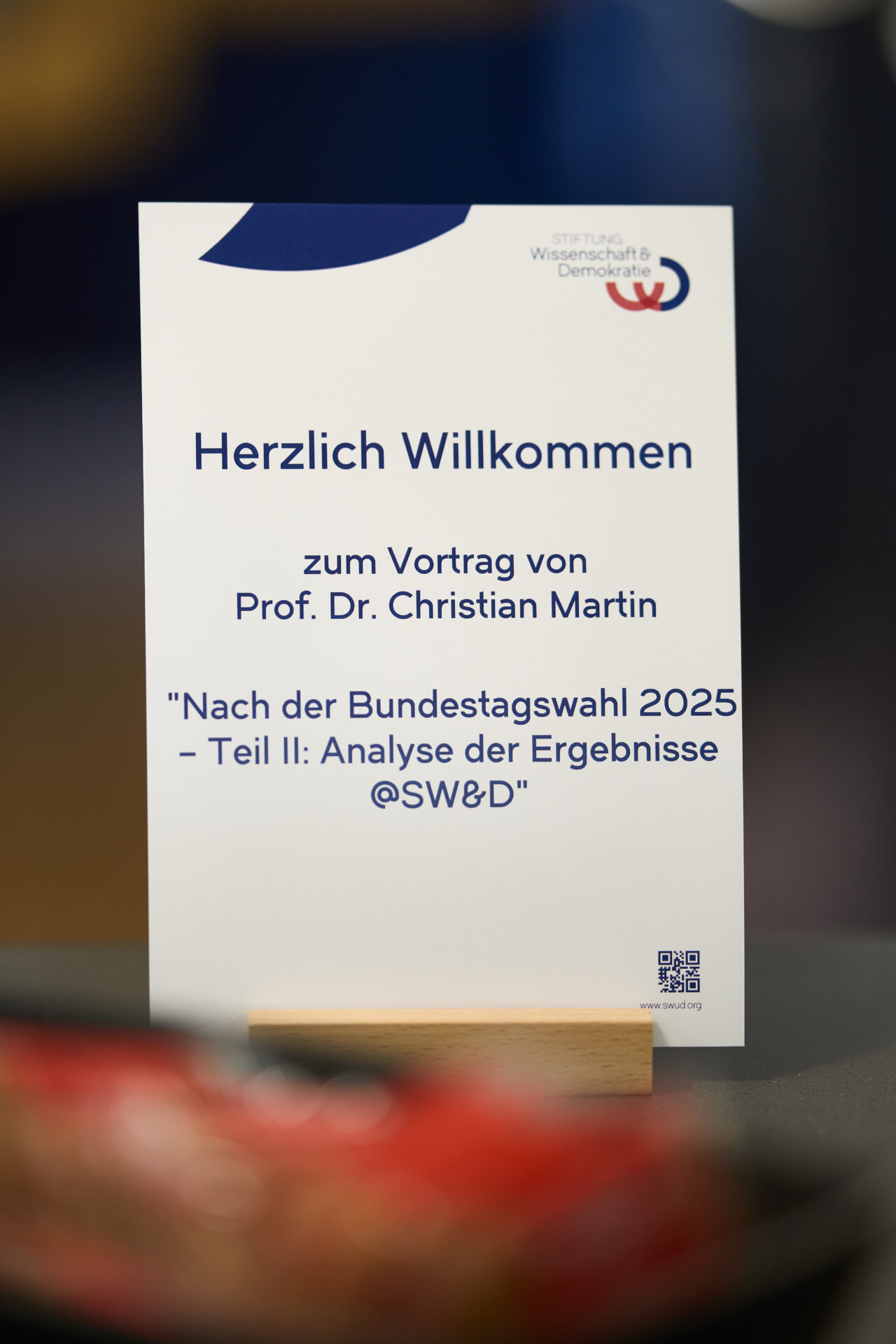Wenn in einer Demokratie der Souverän gesprochen hat, indem die wahlberechtigten Bürger*innen bei einer Parlamentswahl ihre Stimme abgegeben haben, dann sollte man meinen, dass die politischen Verhältnisse klar sind. Dennoch ist meistens das Gegenteil der Fall. So geben die Ergebnisse der Wahl selbst für politische Beobachter*innen oft schon Rätsel auf: Das Abschneiden der einzelnen Parteien weicht nicht nur oft von den vorherigen Umfragen ab, sondern ist auch für Expert*innen oft schwer zu erklären. Abgesehen von offenkundigen Überraschungen beim Wahlergebnis sind insbesondere die „Wähler*innenwanderungen“ Gegenstand öffentlicher und wissenschaftlicher Diskussionen. Auch die Fragen, welche sozialen Gruppen und Milieus welche Partei gewählt und welche Themen die Wahlentscheidung maßgeblich beeinflusst haben, werden in der Regel diskutiert.
Hinzu kommt, dass insbesondere in Staaten mit Verhältniswahlrecht die Koalitionsverhandlungen zwischen den Parteien erst nach der Wahl beginnen. Bei der vorgezogenen Bundestagswahl am 23. Februar 2025 konnte man – mit einem gewissen Zweckoptimismus – davon ausgehen, dass es nach dem Platzen der Ampelkoalition und der anschließenden rot-grünen Minderheitsregierung wieder eine parlamentarische Mehrheit geben könnte, die für politisch klarere Verhältnisse sorgen würde: Nicht zu Unrecht kursierte in weiten Teilen der Bevölkerung die Hoffnung, dass aus den neuen Mehrheitsverhältnissen eine neue Regierung hervorgeht.
Um Klarheit in diese Gemengelage nach der Bundestagswahl zu bringen, waren in den Wochen nach der Wahl gleich an zwei Terminen Politikwissenschaftler*innen der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel bei der Stiftung Wissenschaft und Demokratie zu Gast: Am 26. Februar 2025 tauschten Prof. Dr. Simone Wegmann, Prof. Dr. Wilhelm Knelangen und Prof. Dr. Christian Martin in einer von Jan Meyer (SW&D) moderierten Podiumsdiskussion erste Eindrücke und Erklärungen zum Wahlergebnis aus und gaben einen Ausblick auf mögliche Konstellationen und Prozesse der Regierungsbildung in den kommenden Wochen. Am 6. März war Christian Martin erneut zu Gast, um diesmal in einem Einzelvortrag eine detaillierte Analyse des Wahlergebnisses vorzunehmen.
Eine richtungweisende Wahl in unsicheren Zeiten
Sowohl in der Diskussion als auch im Vortrag wurde deutlich, dass diese Wahl aufgrund der politischen Begleitumstände und Krisen aus mehreren Gründen außergewöhnlich war. Zunächst sorgten die hohen Umfragewerte der AfD bereits im Vorfeld dafür, dass die Demokratie als bedroht und die Wahl in diesem Zusammenhang als richtungsweisend wahrgenommen wurde. So drückte Dr. Astrid Kuhn, die bei der Podiumsdiskussion als Vorstandsvorsitzende und Geschäftsführerin der SW&D ein Grußwort beisteuerte, bereits das aus, was wohl die meisten Anwesenden am Wahlsonntag bewegte: Die Hoffnung, dass die große Mehrheit der Wahlberechtigten ihr Kreuz bei einer demokratischen Partei machen würde. Das gute Ergebnis der AfD, die erstmals als zweitstärkste Kraft in den Bundestag einzog, hätte angesichts der Umfragen in den Wochen vor der Wahl noch höher ausfallen können – für Simone Wegmann war das Zurückbleiben des Wahlergebnisses hinter den Erwartungen sogar die Überraschung des Wahlabends.
Galt in den 1990er und 2000er Jahren die „Politikverdrossenheit“ als Gefahr für die deutsche Demokratie, so scheint diese Sorge zumindest mit Blick auf die Wahlbeteiligung heute unbegründet: Mit 82,5 Prozent der Wahlberechtigten gingen so viele Menschen zur Wahl wie seit 1998 nicht mehr. Angesichts der heute vielfach ausgerufenen Krise der Demokratie könnte diese Wahlbeteiligung zumindest ein Hoffnungsschimmer sein. Die Teilnehmer*innen der Podiumsdiskussion vertraten hier jedoch eine andere Position. So wies Christian Martin an beiden Abenden darauf hin, dass vor allem die AfD von der hohen Wahlbeteiligung profitiert habe, da sie die meisten Stimmen aus der Gruppe der Nichtwähler*innen für sich gewinnen konnte. Für ihn sei die Wahlbeteiligung keine gute Nachricht, da sie in diesem Fall zur Stärke einer demokratiefeindlichen Partei beigetragen habe.
Strategien im Umgang mit der AfD: Die Brandmauerdebatte
So war die AfD und der Umgang mit ihr das Hauptthema der Podiumsdiskussion. Im Mittelpunkt stand dabei die Debatte um die „Brandmauer“, die gegenüber der AfD errichtet worden sei, um die demokratischen Institutionen vor einer Übernahme durch die AfD zu schützen. Dass Friedrich Merz als Kanzlerkandidat der CDU/CSU und einziger mit realistischen Chancen auf dieses Amt eine Abstimmung im Bundestag forcierte, bei der er bewusst eine Mehrheit mit der AfD in Kauf nahm, hatte ihm Kritik von links bis in die Mitte des Parteienspektrums eingebracht. Die anwesenden Wissenschaftler*innen waren sich einig, dass die gemeinsame Abstimmung mit der AfD ein Fehler war.
Sowohl die CDU/CSU als auch die Ampelparteien seien in diesem Zusammenhang der Meinung gewesen, man könne die AfD schwächen, indem man ihre Themen und zum Teil auch ihre Forderungen übernehme. Insbesondere Christian Martin wies darauf hin, dass dieser Ansatz nicht funktionieren könne und die politikwissenschaftlichen Erkenntnisse seit Jahren keinen Zweifel daran ließen. In diesem Punkt stimmten ihm Simone Wegmann und – ausnahmsweise – auch Wilhelm Knelangen nachdrücklich zu: Merz habe dadurch nicht nur keine neuen Wähler*innen gewinnen können, sondern auch seine Optionen mit Blick auf eine erfolgreiche Koalitionsbildung mit SPD oder Grünen geschwächt. Das Merz‘sche „All-in-Gehen“, so resümierte Christian Martin in seinem Vortrag in der Folgewoche, habe nicht funktioniert.
Die Beobachtung, dass die politikwissenschaftlichen Erkenntnisse über dieses strategische Vorgehen in der Politik weitgehend ignoriert werden, schien für die Sprecher*innen keine große Überraschung zu sein. Auch wenn Christian Martin eine Erklärung anbot – die Schwächung der Populisten durch die Übernahme ihrer Positionen sei eine einfache und daher für die Politik naheliegende Lösung – war zu spüren, dass sie sich mehr Aufmerksamkeit für die politikwissenschaftliche Forschung in der Politik wünschen würden.
Angesichts des Abstimmungsverhaltens der Union und der abwertenden Äußerungen mancher ihrer Politiker*innen gegenüber der SPD und vor allem den Grünen sahen die Teilnehmer*innen der Podiumsdiskussion vor allem in der Koalitionsbildung eine große Herausforderung. Sie betonten jedoch, dass angesichts der aktuellen Probleme eine schnelle Einigung eigentlich besonders dringlich sei. Insbesondere in der Außen- und Sicherheitspolitik sei eine handlungsfähige Regierung angesichts des unberechenbaren Verhaltens der zweiten Trump-Regierung unabdingbar.
Wie lässt sich das Wahlerergebnis erklären?
In der Podiumsdiskussion betonten die Wissenschaftler*innen jedoch, dass einige Themen des Wahlkampfes zu kurz gekommen oder falsch kommuniziert worden seien. So wies Christian Martin darauf hin, dass der demografische Wandel das Rentensystem bald überlasten werde. Auch der Klimawandel sei kaum ein Thema gewesen. In Bezug auf Migration als zentrales Thema des Wahlkampfes gaben die Sprecher*innen zu bedenken, dass hier eine problematische Vermischung von Migration und innerer Sicherheit stattgefunden habe: Statt über Probleme der inneren Sicherheit zu sprechen, deren direkter Zusammenhang mit Migration fraglich sei, habe man bei der Migrationsfrage übersehen, dass diese nicht nur negative, sondern auch positive Effekte habe und mit Blick auf den Fachkräftemangel sogar notwendig sei.
Wie Christian Martin in seinem vertiefenden Vortrag darlegte, war jedoch kein einzelnes Thema für den Wahlausgang entscheidend. Vielmehr könne man anhand von Nachwahlbefragungen beobachten, dass neben der inneren Sicherheit und der Migration auch die äußere und soziale Sicherheit sowie die Klimapolitik einen ähnlich hohen Einfluss auf die Wahlentscheidung der Befragten hatten. Martin präsentierte weitere Erklärungsfaktoren für den Wahlausgang, wobei er sich ebenfalls auf die AfD konzentrierte: Die von ihm präsentierten Daten zeigten, dass sich insbesondere der Anteil der Beschäftigten in der Industrie einer bestimmten Region, das Fehlen eines akademischen Abschlusses sowie die Arbeitslosenquote positiv auf das Wahlergebnis der AfD auswirkten. In städtischen Gebieten und Orten mit guter Internetanbindung konnte die AfD tendenziell weniger Stimmenanteile verbuchen. Bemerkenswert ist, dass die AfD ihre stärksten Zugewinne nicht mehr im Osten, sondern im Westen verzeichnen konnte: Die Stärke der Partei als ostdeutsches Phänomen zu interpretieren, sei vor diesem Hintergrund nicht mehr haltbar.
Einen aus politikwissenschaftlicher Sicht sehr aufschlussreichen Unterschied zwischen Ost und West konnte er dennoch ausmachen. Die Verteilung der Parteipositionen im politischen Spektrum ähnele eher der osteuropäischen als der westeuropäischen Parteienlandschaft. Deutlich werde dies an der Verortung der Parteien nach ihrer wirtschaftlichen (links/rechts) und gesellschaftspolitischen (liberal/konservativ) Position. Während die Parteien in Westeuropa in der Regel auf einer Achse von rechtskonservativ bis linksliberal einzuordnen sind, orientiert sich die Parteienstruktur in Osteuropa zwischen einem linkskonservativen und einem rechtsliberalen Pol. Das BSW, das ökonomisch links, gesellschaftspolitisch aber konservativ einzuordnen ist, füllt damit eine Lücke im (ost-)deutschen Parteiensystem.
Sowohl die Podiumsdiskussion als auch der vertiefende Vortrag von Christian Martin regten das Publikum jeweils zu einer lebhaften Diskussion an. Man konnte dabei einen guten Eindruck davon gewinnen, wie sehr das Wahlergebnis und dessen politische Folgen die Kieler Bürger*innen beschäftigt und noch beschäftigen wird. Zugleich ist deutlich geworden, dass politikwissenschaftliche Expertise in Zeiten der Unsicherheit besonders gefragt ist.
Wer nicht an den Veranstaltungen teilnehmen konnte oder sich die Veranstaltungen zur Vertiefung noch einmal in Ruhe anschauen möchte, hat in den folgenden Videos die Möglichkeit, sich die Podiumsdiskussion und den Vortrag (noch einmal) anzuschauen.
Videoaufnahme „Nach der Bundestagswahl 2025 – Teil I: Erste Eindrücke @SW&D – Podiumsdiskussion“
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenVideoaufnahme „Nach der Bundestagswahl 2025 – Teil II: Analyse der Ergebnisse @SW&D von Prof. Dr. Christian Martin“
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenImpressionen